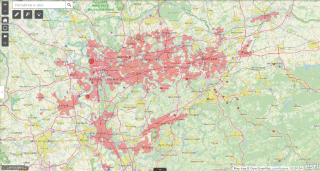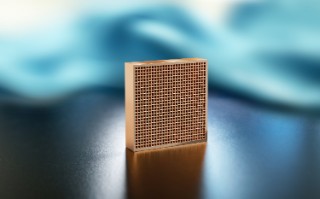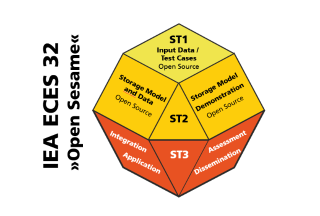Fraunhofer IGB & IMWS / 2020
»Grüner« Wasserstoff als Impulsgeber für eine nachhaltige Chemieindustrie

Wasserstoff ist das Schlüsselelement zur Etablierung einer nachhaltigen Chemieindustrie. Mit der Elektrolysetest- und -versuchsplattform ELP in Leuna, für die heute der feierliche erste Spatenstich erfolgte, übernimmt Sachsen-Anhalt eine Pionierrolle beim Erreichen dieses Ziels. Die Pilotanlage wird Grünen Wasserstoff zur emissionsarmen Herstellung von Grundchemikalien und Kraftstoffen produzieren, das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP in Leuna und das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS in Halle (Saale) bündeln dazu ihre Kräfte.
mehr Info